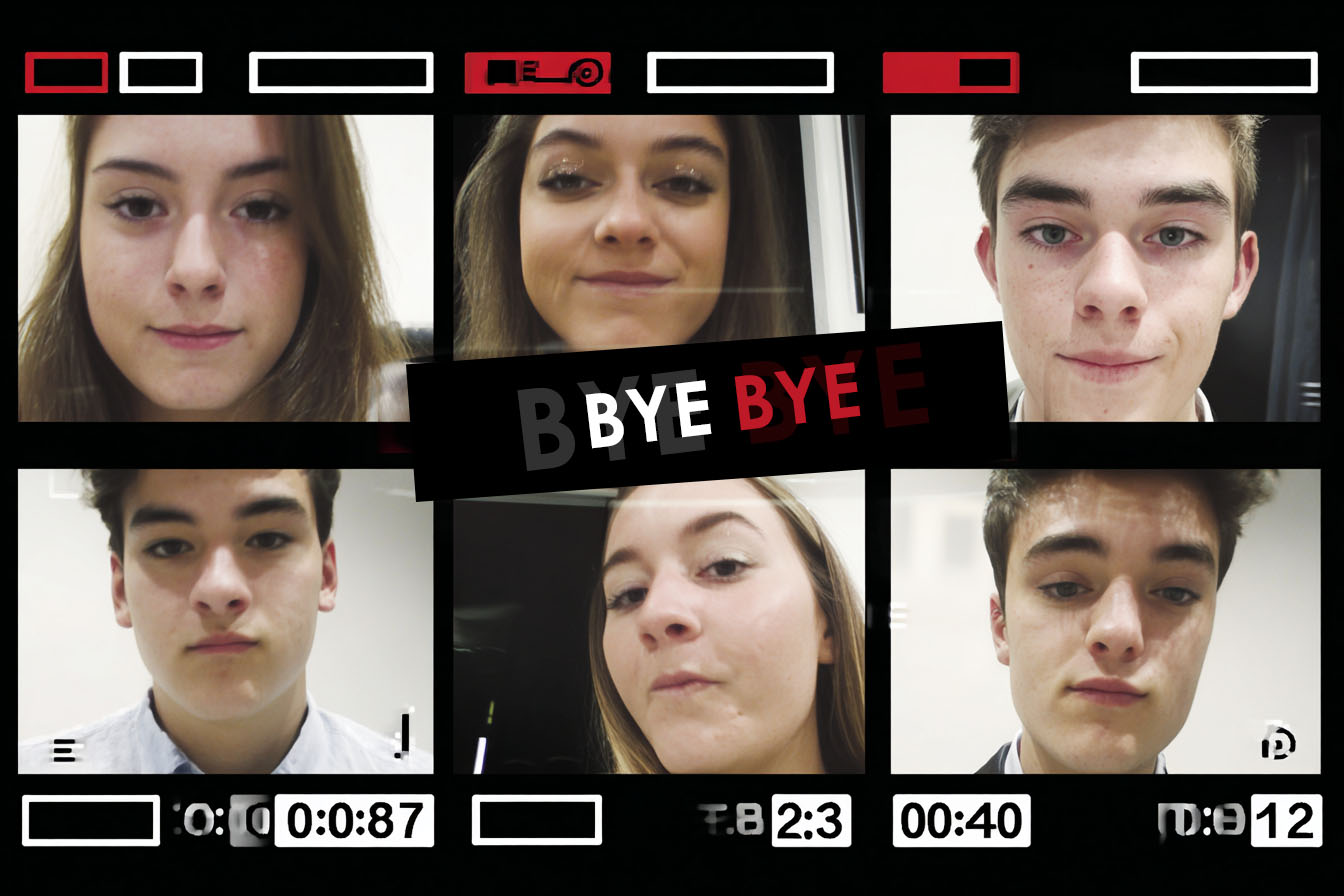Du warst so furchtbar einsam
und dachtest, als ich reinkam,
daß ich immer bei Dir bleibe,
daß ich Dir die Zeit vertreibe,
daß ab jetzt sich alles ändert,
als ich kam hereingeschlendert.
Tja, mein herzig Liebchen mein..
Ich glaub so wird es immer sein.
Der Mensch sich Illusionen macht.
Auf Wiedersehen, Tschüss, Gut' Nacht!
Die Ontologie der temporären Präsenz: Eine philosophische Betrachtung des Cord'schen Abschieds-Paradoxons
Eine kritische Analyse des lyrischen Werks "Zum Abschied" (ca. 1995)
Die vorliegende Arbeit untersucht das bislang in der Forschung sträflich vernachlässigte Gedicht eines deutschen Dichters der späten 90er Jahre. Dabei wird erstmals der Versuch unternommen, die darin enthaltene "Dreifache Abschieds-Sequenz" (DAS) als eigenständiges philosophisches Konzept zu etablieren.
1. Einleitung: Das Problem der Illusion
Bereits Platon warnte in seinem Höhlengleichnis vor den Gefahren der Täuschung. Doch während Platon sich noch mit Schatten an Wänden beschäftigte, geht der unbekannte Autor unseres Gedichts einen Schritt weiter: Er beschäftigt sich mit der Täuschung durch physische Anwesenheit. Eine Revolution des philosophischen Denkens, die in ihrer Tragweite kaum zu überschätzen ist.
2. Die Hermeneutik des Hereinschlenderns
Der Akt des "Hereinschlenderns" (Vers 6) ist von zentraler Bedeutung. Im Gegensatz zum "Hereinstürmen" oder "Hereinplatzen" impliziert das Schlendern eine bewusste Langsamkeit, die beim Beobachter (dem "Du" des Gedichts) falsche Hoffnungen weckt. Wir schlagen daher vor, diesen Vorgang als "Schrödinger's Beziehung" zu bezeichnen: Der Hereinschlendernde ist gleichzeitig da und nicht da, anwesend und bereits im Begriff zu gehen.
3. Das Zeitvertreibungs-Dilemma
Vers 4 offenbart eine erschütternde Wahrheit: "daß ich Dir die Zeit vertreibe". Hier liegt ein fundamentales Missverständnis vor. Während das "Du" Zeit vertrieben haben möchte, möchte das "Ich" eigentlich nur... wieder gehen. Diese asymmetrische Erwartungshaltung führt unweigerlich zum Kollaps der gemeinsamen Realität. Wir nennen dies das "Cord'sche Unschärfe-Prinzip der Beziehungsdauer".
4. Die Dreifache Abschieds-Sequenz (DAS)
Der wahre Geniestreich des Werkes offenbart sich in Vers 10: "Auf Wiedersehen, Tschüss, Gut' Nacht!" Hier manifestiert sich eine bisher unbekannte Form der linguistischen Redundanz mit therapeutischer Funktion.
Die drei Abschiedsformeln repräsentieren verschiedene zeitliche Ebenen:
- "Auf Wiedersehen" - die höfliche Lüge (wir sehen uns nie wieder)
- "Tschüss" - die pragmatische Realität (ich gehe jetzt)
- "Gut' Nacht" - die endgültige Finsternis (es ist vorbei, Licht aus)
Diese Dreifaltigkeit des Abschieds könnte als literarische Entsprechung zum buddhistischen "Dreifachen Pfad" verstanden werden - nur halt in die andere Richtung.
5. Das "herzig Liebchen mein" als postironische Geste
Die Verwendung von "herzig Liebchen mein" in Vers 7 ist ein Meisterstück der Ambivalenz. Es klingt wie aus einem Volkslied des 19. Jahrhunderts, wird hier aber zur Waffe der Distanzierung. Der Autor bedient sich einer Sprache der Nähe, um maximale Distanz zu schaffen. Hegel hätte seine helle Freude daran gehabt - Dialektik in Reinform.
6. Die Illusions-These: Warum der Mensch nicht lernt
Vers 8-9 enthalten die eigentliche philosophische Kernaussage: "Der Mensch sich Illusionen macht." Die grammatikalisch eigenwillige Konstruktion (das fehlende Verb "sich" statt "macht sich") deutet auf die Brüchigkeit der menschlichen Selbsttäuschung hin. Der Mensch MACHT sich keine Illusionen - der Mensch IST Illusion.
7. Existenzialistische Implikationen
Sartre schrieb, die Hölle seien die anderen. Der Autor unseres Gedichts geht weiter: Die Hölle ist die Erwartung, dass die anderen bleiben. Das Gedicht ist somit eine Absage an jede Form von Kontinuität - ein radikaler Nihilismus der Beziehung.
8. Kritische Würdigung und Ausblick
Das Werk steht in der großen Tradition der deutschen Trennungsliteratur, irgendwo zwischen Goethes "Willkommen und Abschied" und dem Rausschmiss nach der letzten WG-Party. Es vereint Pathos und Banalität, Tiefe und Oberflächlichkeit zu einer synthetischen Einheit.
Zukünftige Forschung sollte untersuchen, ob die im Gedicht beschriebene Haltung möglicherweise auch die hohe Single-Quote in Süddeutschland erklärt.
Schlussfolgerung
Das Gedicht "Zum Abschied" ist ein unterschätztes Meisterwerk der deutschen Nachwendeliteratur. Es verbindet philosophische Tiefe mit der Lakonie eines Menschen, der einfach nur seine Ruhe haben will. In seiner brutalen Ehrlichkeit liegt eine Form von Weisheit, die wir vielleicht alle hätten haben sollen, bevor wir "hereinschlenderten".
Literaturverzeichnis
- Cord, F. (ca. 1995): "Tschüss". Unveröffentlichtes Manuskript, vermutlich auf einem Bierdeckel.
- Diverse Ex-Freundinnen (1990-1999): Mündliche Überlieferungen. Nicht mehr erreichbar.
- Sartre, J.P.: Hätte dieses Gedicht geliebt, hat es aber nie gelesen.